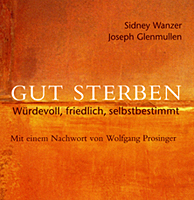
Das Buch „Gut sterben“ der amerikanischen Ärzte Wanzer und Glenmullen entspricht in weiten Teilen dem (etwas neueren) Buch von de Ridder: „Wie wollen wir sterben„, das ich letzte Woche hier vorgestellt habe. Geht de Ridder die Frage nach einem menschenwürdigen Sterben mehr von der ärztlichen Seite an, bzw. über die Probleme, die von ärztlich-medizinischer Seite aus in dieser Hinsicht bestehen, so wird die Argumentation in diesem Buch „pragmatischer“ und mehr aus der Sicht der Betroffenen her geführt.
Das Ergebnis beider Ansätze ist vergleichbar: Spricht Ridder von einem Wechsel im Behandlungsziel, so nennen es Wanzer und Glenmullen: den ersten Wendepunkt. Beide meinen damit aber dasgleiche: der Ziel des ärztlichen Wirkens darf ab einem bestimmten Stadium, welches durch die Offensichtlichkeit, den vorab geäußerten und in einer Patientenverfügung niedergelegten Patientenwillen oder durch den mutmaßlichen Willen des Betroffenen bestimmt ist, nicht mehr auf Therapie, also Heilung, ausgerichtet sein, sondern es darf sich ausschließlich und nur noch mit der Linderung der Schmerzen des Betroffenen befassen (Wechsel vom curativen zum palliativen Behandlungsziel). Der durch diesen Wechsel des Behandlungsziels eventuell früher eintretende Tod ist als natürliches Ereignis zu akzeptieren. Für einen der Autoren war das Schicksal seiner eigenen (schon dementen) Mutter prägend: dieser wurde – trotz gegenteiliger Patientenverfügung – noch im Alter von 92 Jahren ein Herzschrittmacher eingepflanzt, der ihr weitere 5 Jahre Siechtum und Dahindämmern bescherte…..
Die Autoren behandeln die Fragen einer ausreichenden Schmerztherapie, die bis auf ganz wenige Ausnahmen praktisch immer möglich ist, aber von Ärzten oft nur halbherzig durchgeführt wird. Starke Schmerzmittel (Opiate) können auch die Lebenszeit verkürzen, also den Todeszeitpunkt vorverlegen, ein Faktum, welches man wissen muss, wenn man die Verabreichung solcher Mittel im Vorab verfügen will.
Das Buch nimmt wie schon angedeutet, oft die Sicht eines Betroffenen ein, wobei als Betroffene nicht nur die Patienten gesehen werden dürfen, sondern auch alle Menschen im direkten Umfeld, die den Krankheits- bzw. Sterbeprozess auf die eine oder andere Weise begleiten. In einem ausführlichen Abschnitt werden die Rechte des Sterbenden diskutiert, auch wenn dies sich auf amerikanische Verhältnisse bezieht, sind sie meiner Meinung nach auch gut auf deutsche übertragbar. Ebenso sinnvoll ist der Abschnitt, in dem die Autoren darauf eingehen, was man als Betroffener von seinen Arzt erwarten darf und kann, wie man ihm gegenüber treten sollte und welche Fragen im Vorab zu klären sind. Mehr als einmal wird dazu geraten, unter Umständen auch den Arzt zu wechseln, wenn der behandelnde nicht die notwenigen Garantien geben kann, im Sinn des Sterbenden zu agieren. Natürlich werden auch Fragen zur Patientenverfügung, zu Vorsorgevollmachten etc pp praxisnah behandelt.
Nennen die Autoren den Wechsel vom Curativen zum Palliativen den ersten Wendepunkt, so deutet das schon darauf hin, daß es nach ihrer Ansicht auch einen zweiten Wendepunkt gibt. Für den Fall, daß lindernden Maßnahmen der palliativen Medizin nicht wirken und der Sterbende unter unerträglichen Schmerzen leidet, kann es sein, daß der Entschluss reift, daß der Tod diesem Leben vorzuziehen ist. Es entsteht der Wunsch, das Sterben zu beschleunigen. Im Vergleich zu Ridder, der dieses Thema zwar auch anschneidet und diskutiert, gehen Wanzer und Glenmullen ausführlicher darauf ein, inclusive einer Beschreibung und Bewertung von Methoden, das Leben zu verkürzen (so die etwas beschönigend klingende Übersetzung, „to Hasten Death“ im Englischen). Dieses Thema um aktive/passive Sterbehilfe, eventuell auch bei Menschen, die sich nicht akut im Sterbeprozess befinden, sondern wegen anderer Gründe ein (subjektiv und darauf kommt es an) menschenunwürdiges Leben führen müssen bzw auch bei Dementen (deren Problemen wird ein ganzer Abschnitt gewidmet), ist emotional aufgeladen, nicht nur in Deutschland. Die beiden Autoren beziehen für sich ganz eindeutig Stellung, die immer – soweit gewisse Bedingungen erfüllt sind – den Willen, die Selbstbestimmheit, des Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Facit: Ein sehr informatives und praktisch gehaltenes Buch zu der Frage, was man unternehmen soll und kann, wenn man für sich ein würdevolles Sterben sicherstellen will.
Sidney Wanzer, Joseph Glenmullen
Gut sterben
Zweitausendeins, 2009, TB, 264 S.
ISBN 978-3-86150-895-3
Ein Kommentar zu „Sidney Wanzer, Joseph Glenmullen: Gut sterben“